Film „ERNTE TEILEN“
Der Film „ERNTE TEILEN“ wurde am Fr, 14.06.2024, 19.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen gezeigt.
Es waren 26 Zuschauer da. Die Getränke wurden von dem Kooperationspartner der Mitmach-Region Deggenhausertal, der Mosterei Kopp gespendet.
Timm Cebulla begrüßte um 19.00 Uhr die Zuschauer. Danach wurde der Film „ERNTE TEILEN“, gezeigt, der 1,5 Std dauerte.
Der Dokumentarfilm „ERNTE TEILEN“ erzählt die Geschichte von Bäuerinnen und Bauern, die aus den Strukturen der herkömmlichen Landwirtschaft ausbrechen.
Der Film beginnt damit, dass der Filmemacher Philipp Petruch sich Gedanken über die Erzeugung von Lebensmitteln macht und dabei feststellt, dass ihm das bisherige System zur Erzeugung von Lebensmitteln nicht zusagt und auf Dauer auch nicht mehr funktionieren wird. Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten besucht er Betriebe der solidarischen Landwirtschaft (Solawis), von denen er drei im Film vorstellt. Diese Solawis sind in Mecklenburg Vorpommern und Brandenburg.
Die Betreiber der Solawis erzählen im Film ihre Geschichten, wie sie sich von den für sie überholten Strukturen verabschiedet und den Weg zur solidarischen Landwirtschaft gefunden haben. Sie erzählen von ihren Problemen, von den Hindernissen auf diesem Weg, aber auch von der Freude und der Erfüllung, die diese neue Struktur für sie bringt. Bei allen Berichten klingt durch, dass die Arbeit in der Solawi und die Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Solawi das Leben bereichern. Und dass vor allem auch die Wertschätzung, die ihre Arbeit zur Herstellung von Lebensmitteln in der Solawi erfährt, ihnen gut tut und ihnen dadurch die Arbeit viel Freude bereitet. Das sei eine Lebensqualität, die man mit Geld nicht kaufen kann.
Generell kann man sagen, dass es der Solidarische Landwirtschaft gelingt, neue Wege und Lösungen zu finden. Wege, die ohne Umweltzerstörung und Profitgier auf der Basis von Menschlichkeit, Gemeinschaft und Achtung vor der Natur, eine Erzeugung qualitativ hochwertiger Lebensmittel ermöglichen und die Menschen vor Ort damit zu versorgen.
Nach dem Film lud Timm Cebulla zu einer Diskussionsrunde ein, zu der mehrere Betreiber von Solawis aus der Region eingeladen worden waren.
Maria Schlegel von der Solawi Heiligenberg stellte ihre Solawi vor, die seit 4 Jahren besteht. Sie fand es gut, dass in dem Film Solawis mit kleinen Strukturen gezeigt wurden, so wie es bei uns in der Region auch der Fall ist. Die Solawi Heiligenberg baut nur samenfeste Sorten an und zieht die Jungpflanzen selbst. Der Gemüseanbau erfolgt u.a. mit Market Gardening. Das ist eine Methode, die nach den regenerativen Prinzipien der Permakultur auf kleiner Fläche möglichst viel Ertrag ermöglicht. Am 21.06.2024 findet eine Exkursion zur SoLaWi Heiligenberg statt.
Bernhard Will stellte die Solawi Bodensee e.V. vor, die es seit 8 Jahren in Friedrichshafen-Raderach gibt.
Daniel erzählte von den Problemen der Solawi Andreashof, die seit einem Jahr besteht.
Claudio Spener und Otto Metzger berichteten von der Apfelsolawi Rußmaier in Kappel bei Horgenzell. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, neue, robuste Apfelsorten, wie z.B. Rusticana, die wenig Pflanzenschutz benötigen und gut lagerfähig sind, anzubauen.
Die Solawis in der Region verbindet eine gute Zusammenarbeit. So werden die Äpfel der Apfelsolawi auch in den anderen Solawis verkauft. Ebenso werden Überschüsse von Eiern, Kartoffeln oder Zwiebeln von anderen Höfen über die Solawis verteilt.
Nach der Vorstellung der Solawi-Betreiber gab es eine kurze Vorstellungsrunde der Zuschauer, bei jeder sein Interesse an dem Thema und Anmerkungen und Vorschläge äußern konnte. Einer Lehrerin aus Untersiggingen war es z.B. ein Anliegen, Informationen über Solawis auch in die Schulen zu tragen. Generell wünschten sich die Zuschauer mehr leicht zugängige Informationen über Solawis, so z.B. auch im Gemeindeblättchen.
Eine Anregung, die auch vorgestellt wurde, war, im Deggenhausertal eine Abholstelle für die Gemüsekisten der Solawis einzurichten. Es gibt eine Möglichkeit, die sehr wahrscheinlich auch umgesetzt wird.
Der interessante und informative Abend klang in lebhaften Einzelgesprächen aus.
Informationen zu den einzelnen Solawis:


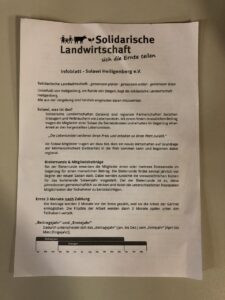
Informationen zum Film: https://wirundjetzt.org/event/filmabend-ernte-teilen/
Trailer zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=dbJ_2dpEKBE
Gefördert von:

Kooperationspartner:



Weitere Informationen und Gedanken zum Thema „Solawi“ von Timm Cebulla:
Im Film wurde den brandaktuellen Fragen unserer Zeit nachgegangen,
• wie ein Preis für ein gesundes Lebensmittel entsteht, der bezahlbar für jeden
Verbraucher ist, und der gleichzeitig auskömmlich für den Erzeuger ist
• was überhaupt ein gesundes Lebensmittel ist – gesund für den Verbraucher, für den
Erzeuger, und für Tiere, Pflanzen und Boden
Auf beide Fragen können die Antworten im Falle einer Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft wie der
SoLaWi gemeinsam im Konsens gefunden werden. Eine SoLaWi ist genau dazu da, dass
gemeinsam das Beste für alle erreicht wird. Dies wird möglich durch ein faires, ehrliches
Miteinander, durch kurze Wege, nahe Beziehungen, und somit durch Transparenz, das Teilen von
Fragen und Wissen.
In diesem Konstrukt sind Dinge möglich, die sonst nicht möglich sind – ein Geben und Nehmen auf
beiden Seiten. Der Verbraucher wird zum Mitbauer oder Vereinsmitglied – er legt sich für ein
ganzes Jahr fest, monatlich dem Erzeuger einen festen Betrag zu zahlen – und lebt im Vertrauen,
dafür etwas zurückzubekommen, was dem Wert seiner Zahlung entspricht. Dafür bekommt er
Lebensmittel, die wirklich gesund sind, über deren Herstellung er sich jederzeit hautnah informieren
kann, oder an der er sogar mitwirken kann. Sie sind maximal frisch dank der kurzen Transportwege.
Der Erzeuger profitiert dank der verbindlichen Abnehmer all seiner Erzeugnisse von einer großen
Planungssicherheit sowie von einer besonderen Lebensqualität, die in Euro oder in Zahlen und
Ziffern gar nicht messbar ist: er erlebt Wertschätzung und er weiß für wen er arbeitet. Die
Verbraucher heißen es auch gut, wenn er eine Vielfalt an Kulturen anbaut, was in der normalen
Wirtschaftswelt quasi unmöglich ist.
Denn die typischen Kriterien der industriellen Landwirtschaft sind Ertragsmasse, Lagerfähigkeit
und Transportfähigkeit. Dadurch kommt es zwangsläufig zu Spezialisierung, Monokultur, und auch
höherem Pestizid-Einsatz. Nachrangige Rollen spielen Geschmack, Gesundheit und Wohlergehen
der Beteiligten, sowie Bodenqualität und andere Umweltaspekte. Und dann ist da noch die große
Einsamkeitsfalle des weitgehend anonymen Wirtschaftssystems, in dem kaum jemand weiß, zu
welchen Menschen die eigene Arbeitskraft eigentlich fließt, in dem außer ein kühl kalkulierter Preis
oder Lohn kaum Wertschätzung und Sinn erfahrbar ist, und in dem man auch selten weiß, woher die
eigene Nahrung kommt und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurde.
Bei der SoLaWi gibt es nicht nur Gemeinschaft mit menschlicher Wärme, sondern auch die Umwelt
profitiert: Die Ernte wird 100% aufgeteilt auf alle Mitglieder, nichts wird verschwendet. Alles
geschieht lokal und regional auf kurzen Wegen, es gibt keine langen Transporte, und auch keinen
Verpackungsmüll. Das meiste ist saisonal, wodurch auch Lageraufwand eingespart wird. Die
lebendige Vielfalt an Kulturen ist auch gut für die Artenvielfalt und Böden.
All diese Vorteile legen die Frage nahe, was noch passieren muss, damit noch mehr Menschen
alternative Wirtschaftsmodelle wie das der SoLaWi aufbauen und nutzen?
„Spätestens dann, wenn die Preise der Produkte industrieller Landwirtschaft steigen, wird sich das
Verhalten der Menschen ändern. Die derzeit noch niedrigen Preise werden nicht bleiben“ war eine
Aussage im Film. Denn die Böden und die Umwelt werden zerstört und die Produktion wird
dadurch zunehmend schwieriger und teurer.
Bei manchen Menschen rücken die Probleme und mögliche Lösung natürlich auch schon früher ins
Bewusstsein – nicht erst dann, wenn es sich die gewohnten Wege wirtschaftlich für den Einzelnen
nicht mehr rechnen.
Oft ist die erste Reaktion der Anbau im eigenen Garten. Doch hier kommen die meisten schnell an
einen Punkt der Überforderung – so war es bei vielen Menschen, die im Film einer SoLaWi
beigetreten sind. Denn Nahrungsmittelproduktion, ob Tiere oder Pflanzen, brauchen jeden Tag
Aufmerksamkeit.
Eine andere Subventionspolitik könnte auch helfen: wenn statt großen Flächen im Gegenteil die
kleinen Strukturen gefördert würden. Dabei geht es nicht nur um SoLaWis, es braucht eine Vielfalt
neuer Ansätze.
Und schließlich braucht es Mut! Es braucht Menschen, die für etwas einstehen, was sie für richtig
halten. Die ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen, wenn es mal schwierig wird. Eine
Gemeinschaft wie die SoLaWi hat hier den Vorteil, dass man nicht alleine ist – „es macht einen
Unterschied, ob beim Bürgermeister 1 Brief oder 20 Briefe ankommen“ sagte jemand im Film.
Außerdem kennt jeder irgendwen, z.B. in einer Partei oder Kirche, und gemeinsam kommt man
voran.
Filmgespräch: übergeordnete Fragen unserer Kultur des Miteinanders, und Einblicke in
SoLaWis der Region
Ein Teilnehmer machte deutlich, dass es ja um viel mehr geht, als um die Frage Bio Ja oder Nein,
oder Regional Ja oder Nein. Es geht um die Frage „Wie wollen wir miteinander leben? Und
arbeiten? Was kann ich tun als kleines Rädchen? Wie kann ich mich mit anderen zusammen tun?
Wie teilen wir uns sinnvoll auf?
Die Apfelsolawi aus Rußmaier bei Horgenzell ist etwas ganz besonderes, weil sie organisch aus
bestehenden Familienstrukturen heraus gewachsen ist. Aus dem, was da ist, statt aus dem Boden
gestampft.
Von der Solawi Heiligenberg ist dagegen zu hören, dass 2020 mit viel Euphorie gestartet wurde,
und dann erstmal schwierige Einigungsprozesse dran waren. Das sei typisch, sagte Maria, die die
Solawi gründete und auch dort Gärtnerin ist: „Jeder hat am Anfang seine Idee und viel Energie
dafür – aber eben vor allem für die eigene Idee und nicht für etwas anderes. Auch wenn die Ideale
bei allen gleich sind, so sind die Vorstellungen der Umsetzungen doch sehr verschieden.“ 2023 sei
das erste Jahr gewesen, in dem der Fokus wirklich auf dem Gärtnern lag. Das liegt auch daran, dass
mittlerweile statt langwieriger Gemeinschaftskreise doch eine gewisse Hierarchie und Struktur
Einzug gehalten hat. „Es gibt einen leitenden Gärtner, und es gibt Mitarbeiter mit klaren Aufgaben
und Grenzen, das bringt Ruhe rein.“
Maria sagt auch: es gibt bei Gemeinschaftsgründungsprozessen immer Energieträger bzw.
Lokomotiven, und die die sich dranhängen. Erst nach einer Weile sortiert sich dies und es wird klar,
mit wem man rechnen kann… Der Film sowie die Gespräche davor und danach zeigen: Wenn sich
Menschen zusammen tun, gibt es viele Fragen zu entscheiden, z.B.:
• Die Grundfrage: wem gehört der Grund und Boden? Zu welchen Konditionen ist er nutzbar?
• Strukturfragen: Sind wir eine Solawi, ein Gemeinschaftsgarten oder etwas anderes? Machen
wir auch Bildungsprojekte? Gibt es eine Leitung, gibt es abgegrenzte Aufgabengebiete und
Rollen die vergeben werden?
• Finanz- und Wirtschafts-Fragen: Gibt es bezahlte Tätigkeiten? In welchem Umfang? Wer
trägt das zu welchen Teilen? Wie verteilen wir die Ernte?
• Gärtner-/Fachfragen: Welche Sorten bauen wir an? Welche Tiere halten wir?
• Kulturelle Fragen: Wie gehen wir miteinander um? Welche Treffen gibt es? Machen wir
auch Feste?





